KI kann heutzutage ja irgendwie alles: schreiben, rechnen, dichten, zeichnen. Aber kann uns generative KI auch beim Lernen helfen? – Zwischen Zeitdruck und Freizeitstress greifen viele Studierende zu Tools wie ChatGPT, beispielsweise um sich etwa lange Texte zusammenzufassen zu lassen. Doch dies birgt Risiken für das Lernen. Der Beitrag zeigt, warum blosses Delegieren an KI problematisch sein kann und wie KI stattdessen als virtueller Lerncoach genutzt werden kann, um echtes Verständnis zu fördern.

In Kürze zum Hören
Szene aus dem Alltag
Nehmen wir Jerome, Student im zweiten Semester. Seit einer Woche hat er den Auftrag, einen 40-seitigen, anspruchsvollen Fachtext – vollgepackt mit Fachbegriffen und Theorien – zu studieren. Die Diskussion darüber findet bereits morgen früh statt. Gleichzeitig blinkt sein Handy: «In einer Stunde Jam-Session im Bandraum – bist du dabei?»
Jerome lädt den Text kurzerhand in ChatGPT und promptet: «Stichwortartig zusammenfassen.» Nach zehn Minuten hat er die Antwort gelesen und denkt sich, dass er nun ungefähr gleich viel verstanden hat, wie wenn er den Text mühsam selbst gelesen hätte – klappt den Laptop zu, greift zur E-Gitarre und steht pünktlich im Bandraum.
Lernen delegiert – ein Klassiker des De-Skilling
Jeromes Vorgehen ist leider kein Best-Practice-Beispiel für das Lernen mit KI. Anstatt sich aktiv mit dem Inhalt auseinanderzusetzen, überträgt er die Aufgabe an das Tool. Studien zeigen, dass genau diese Form der Nutzung problematisch sein kann: Wird KI vor allem eingesetzt, um Aufgaben möglichst schnell zu «erledigen» oder auf direktem Weg Lösungen zu erhalten, bleiben vertiefte Lernprozesse oft aus (2)(3). Folgen können geringere Eigenaktivität, nachlassende Motivation und ein oberflächliches Verständnis der Inhalte sein.
So zeigt eine Studie, dass Personen beim Schreiben von Essays mit ChatGPT eine geringere neuronale Konnektivität aufweisen und sich Inhalte schlechter merken – ein Effekt, bei dem die Forschenden von einer Form der «metacognitive laziness» («metakognitiven Bequemlichkeit») sprechen, also der Auslagerung kognitiver und metakognitiver Aufgaben an die KI (1). Zwar kann der Einsatz von KI kurzfristig zu Leistungssteigerungen führen, doch in Prüfungssituationen ohne Tools fällt die Leistung deutlich geringer aus (2). Dieses Phänomen wird als «De-Skilling» bezeichnet: Werden Denkprozesse regelmässig an Maschinen ausgelagert, kann das langfristig zu einem Kompetenzabbau führen.
Der gleiche Fall – diesmal lernförderlicher
Dieselbe Situation bietet auch Potenzial für das Lernen mit KI – wenn Jerome die KI nicht als blosse Erledigungshilfe, sondern als «Lerncoach» oder als kritisches Gegenüber zur Reflexion und Weiterentwicklung eigener Ideen nutzt.
- Vollständigkeit prüfen
Jerome lädt das Dokument hoch* und lässt den Text von der KI zusammenfassen. Diese Zusammenfassung gleicht er kritisch mit dem Originaltext ab, um sicherzugehen, dass alle zentralen Inhalte enthalten sind. Denn ihm ist bewusst: KI verfügt weder über inhaltliches Verständnis noch über ein Bewusstsein für Relevanz und Vollständigkeit.
*Achtung: Nutzungsrecht prüfen – Uploads sind nur erlaubt, wenn die Urheberschaft des Textes damit einverstanden ist. - Faktencheck anwenden
Jerome weiss zudem, dass beim Einsatz solcher Tools inhaltliche Unschärfen oder Fehler auftreten können – sogenannte Halluzinationen. Sie klingen oft plausibel, sind aber inhaltlich ungenau oder falsch und aufgrund der formal überzeugenden Sprache schwer zu erkennen. Jerome vergleicht daher regelmässig Fakten aus den KI-Antworten mit der Websuche – mithilfe von zwei bis drei vertrauenswürdigen Quellen – und entwickelt eine Routine im kritischen Prüfen. - Dialog statt Delegation
Mit einem Prompt wie «Du bist mein Coach für selbstreguliertes Lernen. Beantworte meine Fragen auf Basis des hochgeladenen Texts.» nutzt er die KI nicht zur blossen Aufgabenerledigung, sondern als Lernbegleitung. Jerome kann nun gezielt nachfragen und sich Schritt für Schritt ein tieferes Verständnis erarbeiten: «Wie ist der dritte Punkt gemeint? Kannst du ein Praxisbeispiel liefern?» Oder: «In welchen anderen Texten wird dieser Fachbegriff verwendet?»
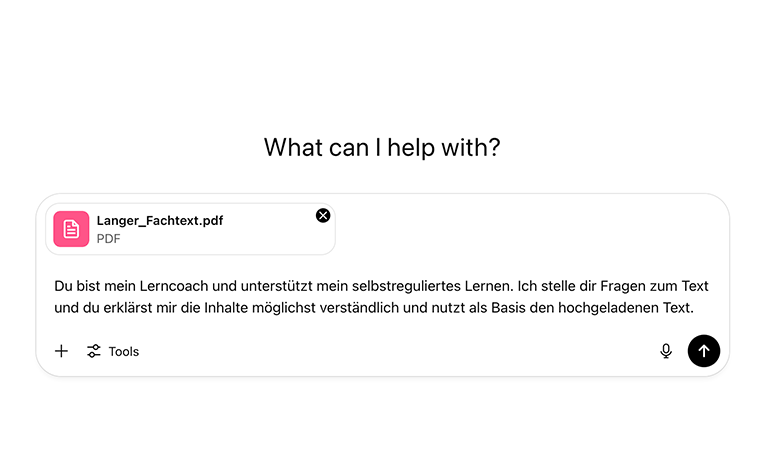
Screenshot aus ChatGPT: Prompt Lerncoach
Diese Art der Nutzung gilt als besonders lernförderlich. Wenn Lernende aktiv mit der KI interagieren, Erklärungen anfordern, vertiefende Rückfragen stellen und die Inhalte reflektieren, wird das Verständnis nachweislich gestärkt (3).
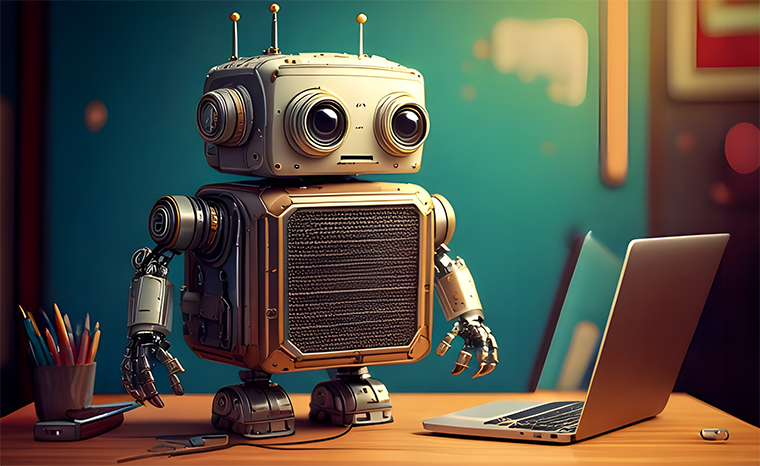
Bild generiert mit Adobe Firefly. Mit dem Prompt «A fusion of a cute robot and an amplifier, standing on a school desk»
KI als Verstärker
Einmal mehr passt in diesem Zusammenhang die Metapher von Jöran Muuss-Merholz: Digitale Medien sind mächtige Verstärker. Sie haben keine eigene Stossrichtung, sondern fungieren lediglich als Verstärker bestehender Tendenzen (4). Im Falle von KI heisst das: Wer sowieso gerne das Lernen abkürzt, findet mit KI eine noch schnellere Abkürzung. Wer dagegen bereits selbstreguliert lernt – sein Lernen plant, durchführt und reflektiert –, kann dies mithilfe einer KI noch gezielter tun und findet in dem Tool einen personalisierten Lerncoach. Wir von den Pädagogischen Hochschulen empfehlen die zweite Variante 😉.
Autorin: Stefanie Mauroux, PH FHNW
17.9.25
Zur Vertiefung
- Die Studie von Kosmyna et al. (2025) Your Brain on ChatGPT gibt Hinweise, dass die Nutzung von LLMs zu geringerer neuronaler Konnektivität und schwächerem Erinnerungsvermögen an die Inhalte führen kann.
- Bastani et al. (2024) Generative AI Can Harm Learning zeigen, dass KI kurzfristig die Leistung in der Übungsphase steigern kann, langfristig jedoch das Lernen schwächt, weil die aktive Auseinandersetzung fehlt.
- Die Studie von Lehmann et al. (2024) AI Meets the Classroom: When Do Large Language Models Harm Learning? kommt zum Ergebnis, dass Studierende profitieren, wenn LLMs als erklärende Tutoren genutzt werden; wird jedoch das Bearbeiten von Aufgaben passiv an die KI überlassen, schmälert dies den Lernerfolg.
- Die von Jöran Muuss-Merholz formulierte Verstärker-Metapher besagt, dass digitale Medien keine eigene Stossrichtung haben, sondern lediglich vorhandene Tendenzen verstärken
Die folgenden Beiträge zu Künstlicher Intelligenz sind bislang auf digibasics.ch erschienen:
https://digibasics.ch/lerntechtrends/chatgpt-im-klassenzimmer/
https://digibasics.ch/lerntechtrends/chatbot-als-persoenlicher-lernassistent/
https://digibasics.ch/lerntechtrends/bilder-generieren-statt-google-suche/
Eine empfehlenswerte kostenlose Plattform mit multimedialen Lerninhalten zu KI: https://ki-campus.org/
Feedback
Vielen Dank für deine Bewertung.